
Im Rahmen unserer fortlaufenden Fachreihe über Wirtschaftskriminalität widmen wir uns in diesem Beitrag dem Straftatbestand des Wirtschaftsbetrugs – einer Erscheinungsform der Wirtschaftskriminalität, die uns in der Praxis in Serbien häufig begegnet. Wie bereits im vorherigen Artikel liegt auch hier der Schwerpunkt vor allem auf praxisbezogenen Aspekten, einschlägiger Rechtsprechung und den zentralen Fragestellungen, mit denen wir im beruflichen Alltag konfrontiert sind. Auf umfangreiche theoretische Ausführungen wird bewusst verzichtet, um den Inhalt einer möglichst breiten Leserschaft aus der Wirtschaft zugänglich und verständlich zu machen.
Wirtschaftsbetrug ist im Artikel 223 des Strafgesetzbuches der Republik Serbien geregelt. Das Gesetz bestimmt: „Wer im Rahmen der Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit, in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, jemanden durch falsche Darstellung oder Verschweigen von Tatsachen täuscht oder in einem Irrtum belässt und ihn dadurch veranlasst, etwas zu tun oder zu unterlassen, wodurch ein Schaden am Vermögen des Unternehmens, für das oder in dem er tätig ist, oder eines anderen Rechtsträgers entsteht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und Geldstrafe bestraft.“
Ähnlich wie bei der zuvor behandelten Straftat (Veruntreuung im Rahmen der Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit), sieht auch dieser Tatbestand zwei strafverschärfende Varianten vor. Eine qualifizierte Form liegt vor, wenn durch die Tat ein Vermögensvorteil in Höhe von mehr als 450.000 RSD (ca. 3.846 EUR) erlangt wurde; in diesem Fall ist eine Freiheitsstrafe von einem bis zu acht Jahren sowie eine Geldstrafe vorgesehen. Die schwerste Form liegt vor, wenn der rechtswidrige Vermögensvorteil mehr als 1.500.000 RSD (ca. 12.820 EUR) beträgt. In diesem Fall sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren sowie eine Geldstrafe vor.

Das geschützte Rechtsgut des Straftatbestands des Wirtschaftsbetrugs gemäß Artikel 223 des serbischen Strafgesetzbuches ist in erster Linie das Vermögen als Ganzes – und nicht nur bestimmte Vermögensformen – derjenigen Akteure, die am Wirtschaftsverkehr teilnehmen. Gleichzeitig wird auch die Rechtssicherheit in diesem Bereich geschützt. Im Unterschied zum einfachen Betrug, bei dem das Vermögen einer Privatperson geschützt wird, schützt der Gesetzgeber hier das Vermögen eines Wirtschaftssubjekts, das eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, also einer juristischen Person, die mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder eines wirtschaftlichen Interesses am Markt teilnimmt (im Sinne von Artikel 112 Absatz 21a des serbischen Strafgesetzbuches).
Im Gegensatz zum allgemeinen Betrug gemäß Artikel 208 des serbischen Strafgesetzbuches, der in unterschiedlichen Alltagssituationen auftreten kann, ist der Wirtschaftsbetrug eng mit der beruflichen Sphäre verknüpft. Der Täter nutzt dabei gezielt geschäftliche Mechanismen sowie die rechtlichen Strukturen von Wirtschaftssubjekten, um sich einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber – konfrontiert mit den Schwierigkeiten, den allgemeinen Betrugstatbestand auf wirtschaftliche Beziehungen anzuwenden – eine spezielle Strafnorm eingeführt, nämlich Artikel 223 des serbischen Strafgesetzbuches. Diese richtet sich auf komplexere und häufig raffinierte Täuschungshandlungen, die sich nicht ohne Weiteres in den Rahmen des allgemeinen Betrugs einfügen lassen. Ziel ist es, die Rechtmäßigkeit und das Vertrauen im Wirtschaftsverkehr zu schützen und die Verletzung marktwirtschaftlicher Verhaltensregeln durch falsche Darstellung von Tatsachen, Verschweigen von Risiken oder das bewusste Aufrechterhalten von Irrtümern bei Geschäftspartnern zu verhindern.
Aus diesem Grund bietet Artikel 223 einen erhöhten Schutz für Marktteilnehmer, indem er eine klare Grenze zwischen akzeptablem unternehmerischem Risiko und strafrechtlich relevanter Täuschung zieht. Auf diese Weise wird die Integrität wirtschaftlicher Beziehungen gewahrt und juristischen Personen ermöglicht, ihre geschäftlichen Entscheidungen auf verlässliche Informationen und wahrheitsgemäße Willenserklärungen zu stützen – ohne befürchten zu müssen, durch perfide Täuschungsmechanismen in wirtschaftlicher Verkleidung benachteiligt zu werden. Die strafrechtliche Norm schützt damit nicht nur die konkreten Interessen der geschädigten Parteien, sondern stärkt auch das Vertrauen in das Marktgeschehen insgesamt.
Obwohl der Betrug gemäß Artikel 208 des serbischen Strafgesetzbuches (sog. „gewöhnlicher Betrug“) und der Wirtschaftsbetrug gemäß Artikel 223 inhaltlich eng verwandt sind, liegt der entscheidende Unterschied im geschützten Rechtsgut. Beim „gewöhnlichen“ Betrug (Art. 208) ist das geschützte Rechtsgut das Vermögen des Einzelnen, also der Schutz vor Täuschung in alltäglichen, häufig außergeschäftlichen Lebensverhältnissen. Demgegenüber wird beim Wirtschaftsbetrug (Art. 223) der Schutzbereich erweitert und umfasst nicht nur das Vermögen der am Rechtsverkehr beteiligten Akteure, sondern auch die Rechtssicherheit und Stabilität im Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit. Besondere Bedeutung kommt dem Erhalt des Vertrauens in die Richtigkeit von Willenserklärungen und die Ordnungsmäßigkeit geschäftlicher Handlungen zu. Dementsprechend ist der Wirtschaftsbetrug strenger sanktioniert und normativ präziser ausgestaltet, da er potenziell erheblichen Schaden für die breitere Wirtschaftsgemeinschaft verursachen kann.

Die Tathandlung beim Wirtschaftsbetrug besteht im Herbeiführen oder Aufrechterhalten eines Irrtums durch falsche Darstellung oder Verschweigen von Tatsachen, mit dem Ziel, dass eine andere Person etwas tut oder unterlässt, wodurch das Vermögen einer juristischen Person geschädigt wird. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem allgemeinen Betrug besteht darin, dass sich der Schaden nicht unmittelbar auf das Vermögen der getäuschten Person beziehen muss, sondern auf das Vermögen eines Unternehmens, bei dem oder für das der Täter tätig ist, oder auf das Vermögen eines dritten Rechtsträgers.
Die Tathandlung ist daher nicht allein im klassischen Zweipersonenverhältnis zwischen Täter und Geschädigtem zu beurteilen, sondern im weiteren Kontext wirtschaftlicher Verantwortung. So läge beispielsweise ein Wirtschaftsbetrug vor, wenn ein Mitarbeiter eines Unternehmens bewusst Informationen über die Zahlungsunfähigkeit eines Käufers verschweigt und dadurch die Geschäftsleitung dazu veranlasst, einen nachteiligen Vertrag abzuschließen.
Der Irrtum als Folge der Tathandlung kann sowohl durch aktives Verhalten als auch durch Unterlassen, also durch das passive Aufrechterhalten einer bereits bestehenden Fehlvorstellung, hervorgerufen werden. Entscheidend ist, dass der Täter von dem Irrtum des anderen weiß und den Willen hat, diesen nicht zu beseitigen. In diesem Sinne erfordert das Aufrechterhalten eines Irrtums kein aktives Verhalten – es genügt, wenn eine Person, die von der Fehlvorstellung Kenntnis hat und verpflichtet ist, diese zu korrigieren (z. B. ein vertraglich verpflichteter Garant), dies unterlässt. So kann etwa ein Verkäufer, der während der Vertragsverhandlungen über den Verkauf einer Ausrüstung den Käufer nicht darüber informiert, dass die vereinbarte Garantie tatsächlich nicht vom Hersteller gedeckt ist, sondern eine Tatsache verschweigt, von der die Gegenseite berechtigterweise ausgeht, wegen Aufrechterhaltens eines Irrtums strafrechtlich verantwortlich sein. Es ist hervorzuheben, dass die Rechtsprechung anerkannt hat, dass das Vorliegen des Tatbestandes bereits dann gegeben ist, wenn der Irrtum real und erheblich war – unabhängig davon, ob der Geschädigte auch unachtsam gehandelt haben könnte.
Darüber hinaus kann die Tathandlung im Zusammenhang mit der Übernahme eines unternehmerischen Risikos stehen, was jedoch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht ausschließt, wenn der Täter bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wusste, dass die vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt werden würden. In einem solchen Fall handelt es sich nicht um eine bloße Nichterfüllung des Vertrags, sondern um eine anfängliche Täuschung – wenn jemand die Form eines wirtschaftlichen Geschäfts nutzt, um durch bewusst falsche Darstellung des tatsächlichen Sachverhalts die andere Vertragspartei in die Irre zu führen. Beispielsweise besteht ein hinreichender Anfangsverdacht für strafrechtliche Verantwortlichkeit, wenn ein Unternehmen einen Werkvertrag abschließt, obwohl der Täter weiß, dass das Unternehmen weder über die Ressourcen noch über die Absicht zur Vertragserfüllung verfügt, sondern den Vertrag allein zur Erlangung einer Vorauszahlung nutzt. Besonders in Fällen mit erheblichen Vermögensschäden (Absätze 2 und 3 des Artikels 223 des serbischen Strafgesetzbuchs) überschreiten solche Handlungen regelmäßig die Grenze des gewöhnlichen unternehmerischen Risikos und stellen eine gravierende Verletzung des Vertrauens im Wirtschaftsverkehr dar.
Die Folge des Grundtatbestands des Wirtschaftsbetrugs besteht im Eintritt eines Vermögensschadens auf Seiten der juristischen Person. Ein bloßer Täuschungsversuch reicht nicht aus; es ist erforderlich, dass eine Person, die durch Täuschung in die Irre geführt oder darin gehalten wurde, eine Handlung vornimmt oder unterlässt, wodurch ein Schaden am Vermögen des Wirtschaftssubjekts verursacht wird. Das bedeutet, der Schaden muss tatsächlich eintreten – ein bloßer Versuch oder eine Gefährdung genügt nicht. In der Praxis handelt es sich meist um Fälle, in denen ein Unternehmen aufgrund falscher Angaben über die Vertragserfüllung (z. B. angeblicher Besitz von Lizenzen, Lagerbeständen, Ausrüstung etc.) eine Vorauszahlung leistet und daraufhin einen finanziellen Verlust erleidet.
Täter dieses Straftatbestandes kann nur eine Person sein, die im Rahmen eines Wirtschaftssubjekts handelt – sei es als Angestellter, verantwortliche Person oder auch als externer Mitarbeiter, der aufgrund eines Vertrags im Namen des Unternehmens tätig wird. Das bedeutet, dass der Täter den Status einer Person haben muss, die „für“ oder „im Namen“ eines Unternehmens handelt. Beispielsweise kann der Täter ein Vertriebsleiter sein, der – in Kenntnis dessen, dass das Unternehmen die vertragliche Verpflichtung nicht erfüllen wird – dem Kunden wahrheitswidrig zusichert, dass die Lieferung fristgerecht erfolgen wird, und dadurch die andere Partei zur Zahlung veranlasst. Der Kern liegt darin, dass die Person die organisatorische Struktur der juristischen Person als Mittel zur Begehung des Betrugs ausnutzt.
Das subjektive Element dieser Straftat ist der direkte Vorsatz. Der Täter muss wissen, dass er falsche Tatsachen vorspiegelt oder einen Irrtum aufrechterhält, und er muss den Willen haben, sich selbst oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Im wirtschaftlichen Kontext stellt sich häufig die Frage, wo berechtigtes unternehmerisches Risiko endet und strafrechtliche Verantwortlichkeit beginnt.
Beispielsweise liegt ein Geschäftsrisiko vor, wenn jemand einen Vertrag abschließt, obwohl er weiß, dass das Unternehmen momentan illiquide ist, jedoch begründete Erwartungen bestehen, dass Einnahmen vor Fälligkeit der Verpflichtung erzielt werden. Wenn jedoch von Anfang an bekannt ist, dass keine Einnahmen vorhanden sind und auch nicht zu erwarten sind, und der Geschäftspartner durch Täuschung zur Zahlung veranlasst wird, liegt der Vorsatz im Sinne des Artikels 223 des Strafgesetzbuches der Republik Serbien vor.
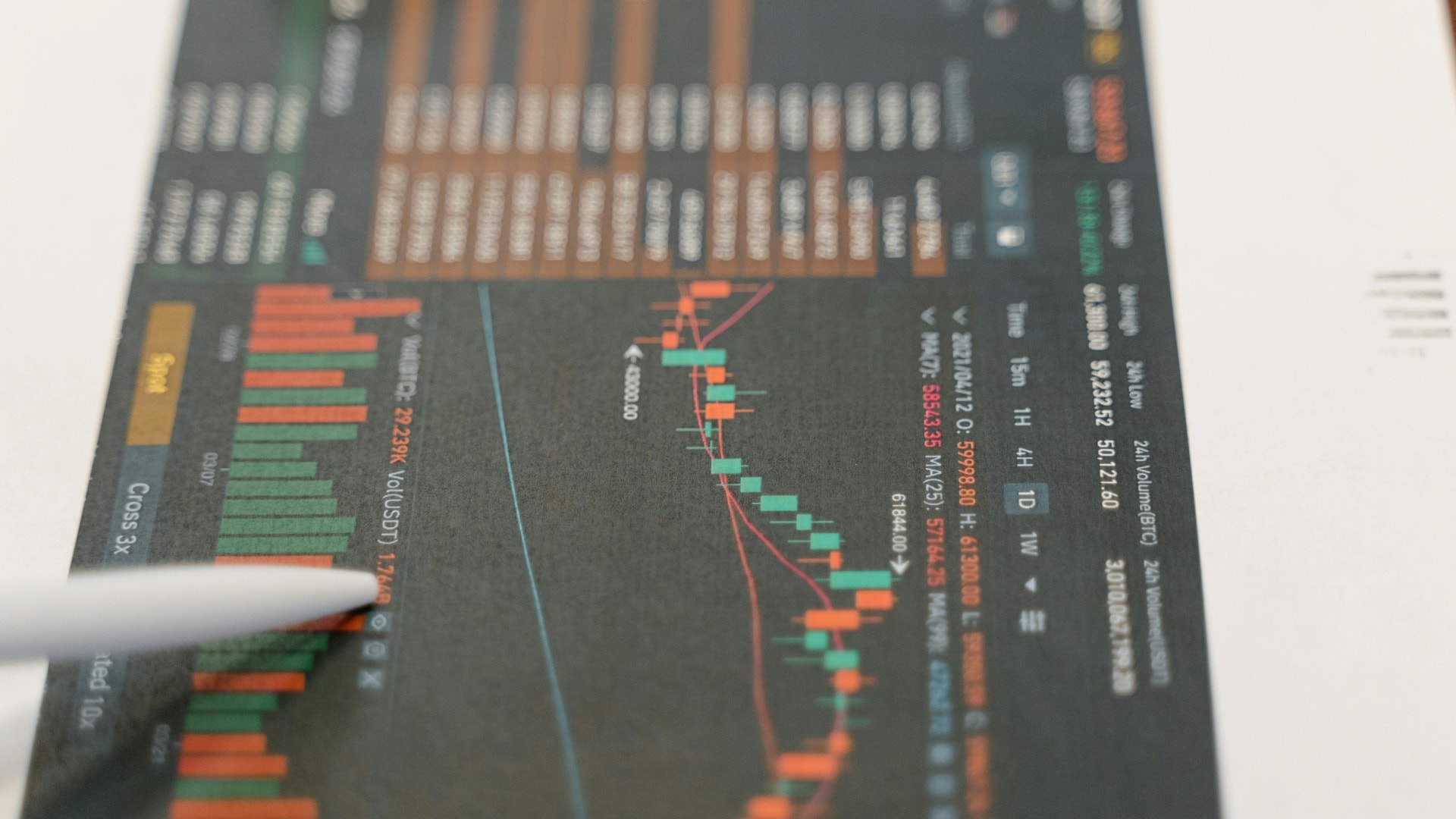
Für die Bearbeitung von Strafanzeigen wegen dieser Straftat ist die Höhere Staatsanwaltschaft – insbesondere die Abteilung zur Bekämpfung der Korruption – zuständig. Diese Zuständigkeit ergibt sich aus Artikel 2 Absatz 1 Punkt 4 des Gesetzes über die Organisation und Zuständigkeit staatlicher Organe zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Terrorismus und der Korruption.
Der Kern dieses Straftatbestands liegt in der Verbindung klassischer Betrugsformen mit den Besonderheiten der Geschäftswelt, in der der äußere Anschein der Gesetzmäßigkeit dazu genutzt werden kann, unrechtmäßige Vermögensvorteile zu verschleiern. Serbien – ein Land, das seine Bemühungen im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität intensiviert – versucht durch spezialisierte Staatsanwaltschaften und verbesserte gesetzliche Rahmenbedingungen eine wirksame Reaktion auf solche Erscheinungen zu ermöglichen. In der Praxis zeigt sich jedoch zunehmend die Notwendigkeit, zwischen akzeptablem Geschäftsrisiko und strafrechtlich relevantem Verhalten zu differenzieren – eine Fragestellung, die sowohl für die Staatsanwaltschaft als auch für Verteidiger von entscheidender Bedeutung ist: Wurde das geschädigte Unternehmen tatsächlich getäuscht oder hat es schlichtweg das Marktrisiko falsch eingeschätzt? Liegt eine strafrechtliche Verantwortung auch dann vor, wenn der Geschädigte die Risiken hätte erkennen können – sie jedoch im Streben nach Gewinn bewusst ignoriert hat? Und wo genau verläuft die Grenze zwischen einem zivilrechtlichen Verhältnis, das sich später zum Betrug entwickelt, und einem solchen, das von Anfang an strafrechtliche Züge trägt?
Aus diesem Grund betrachtet unsere Kanzlei diese Straftat nicht ausschließlich als Instrument der Strafverfolgung, sondern in erster Linie als rechtliches Mittel zum Schutz der Interessen unserer Mandanten. In Kombination mit zivilrechtlichen Instrumenten (Schadensersatz, Vertragsnichtigkeit, Rücktritt, einstweilige Sicherungsmaßnahmen etc.) lässt sich so ein gerechtes und funktionales Ergebnis in komplexen Wirtschaftsstreitigkeiten erzielen. Ziel ist nicht nur die Bestrafung des Täters, sondern auch die Schadensbegrenzung, Rückgewinnung von Vermögenswerten, Schutz des Rufes sowie die Prävention weiterer rechtlicher Risiken. Die frühzeitige Identifikation der Tatbestandsmerkmale in Verbindung mit einer klaren Strategie stellt daher einen entscheidenden Schritt zum Schutz der Rechte und Interessen wirtschaftlicher Akteure in Serbien dar.
Veröffentlicht: 20. Juli 2025
Autor: Kristijan Karan, Rechtsanwalt in Novi Sad, Serbien
Aktuelles & Veröffentlichungen

Neuigkeiten
Kristijan Karan zum Vorsitzenden der Satzungskommission des serbischen Steuerberaterverbands gewählt

Veröffentlichungen
Wirtschaftlich Berechtigte in Serbien: AML/CFT-Kontext und neue Änderungen des Gesetzes über die zentrale Evidenz der wirtschaftlich Berechtigten

Veröffentlichungen



